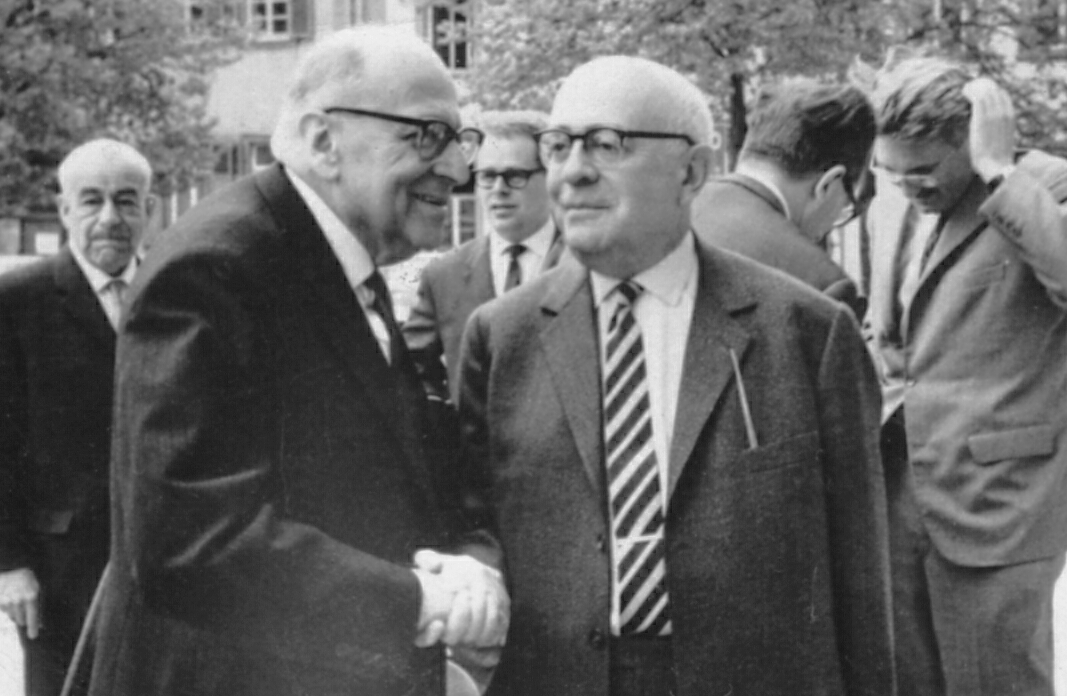Mit Beginn der Industrialisierung in den 1950er Jahren entstand auch ein neues Verständnis für Kunst, das sich unter anderem auch in der Architektur bemerkbar machte. Mit seinen Anfängen in Frankreich als „béton brute“, also „roher Beton“, wurde der Brutalismus bald einer der beliebten Baustile weltweit. Der Anspruch des Brutalismus und seiner Vertreter war, bei Bauwerken keinen Hehl aus der Bausubstanz zu machen, sie sogar in den Vordergrund zu stellen. Aus diesem Anspruch heraus entstand auch die Bewegung des „New Brutalism“, also „neuer Brutalismus“, die sich architektonisch kaum vom „alten“ Brutalismus unterscheidet, bei der die Vertreter aber versuchten, auch den ethischen Aspekt der Architektur mit einzubeziehen und zum Beispiel für faire Löhne auf den Baustellen zu kämpfen.
Brutalismus: eine weltweite Erfolgsgeschichte
Der Brutalismus machte seine Anfänge in Mitteleuropa, genauer in Frankreich, Deutschland und England, während der Industrialisierung der 1950er Jahre, verbreitete sich aber vor allem in den 1960er Jahren rasend schnell auf der ganzen Welt, mit Unmengen von Gebäuden die auch heute noch existieren und teilweise unter Denkmalschutz stehen.
Der Großteil der brutalistischen Bauwerke sind offizielle Gebäude wie Rathäuser, Universitäten und Hochschulen, Bibliotheken oder ähnliche öffentliche Gebäude. Es gibt aber auch Einkaufszentren – zum Beispiel da s Geschäftszentrum „La Pyramide“ an der Elfenbeinküste, das jedoch vom Abriss bedroht ist – oder Wohnhäuser – zum Beispiel der Wohnblock „Harumi“ in Tokio, Japan, der von Maekawa Kunio entworfen wurde, der direkt vom Erfinder des Brutalismus, dem schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier, lernte.
s Geschäftszentrum „La Pyramide“ an der Elfenbeinküste, das jedoch vom Abriss bedroht ist – oder Wohnhäuser – zum Beispiel der Wohnblock „Harumi“ in Tokio, Japan, der von Maekawa Kunio entworfen wurde, der direkt vom Erfinder des Brutalismus, dem schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier, lernte.
Was ist der Unterschied zwischen Plattenbau und Brutalismus?
Auf den ersten Blick erscheint die Idee hinter Plattenbauten und brutalistischer Architektur sehr ähnlich. Es geht um Beton, der gut sichtbar verbaut wurde. Der Unterschied ist aber einfach erklärt und schnell zu sehen, wenn man Plattenbauten aus sozialistischen Regimen mit brutalistischen Gebäuden wie der La Pyramide oder dem Geomatikum der Universität Hamburg vergleicht.
Beim Plattenbau ging es vor allem um effizientes, kostengünstiges und schnelles Schaffen neuen Wohnraums ohne Fokus auf Ästhetik, mit reinem Blick für Funktionalität.
Beim Brutalismus geht es darum, den Baustoff Beton möglichst kunstvoll in Szene zu setzen, mit harten Kanten, Ecken und geraden Linien. Brutalismus ist sehr geometrisch und kommt oft ohne Rundungen oder geschwungene Formen aus – er ist aber letztendlich doch sehr darauf bedacht, ästhetisch ansprechend auszusehen. Dabei wird wenig auf die Effizienz geachtet – manche Gebäude sind in ihrer Grundfläche unnötig groß oder so geschnitten, dass viel Platz verloren geht – sondern hauptsächlich auf eine ansprechende, kunstvolle Darstellung von Beton.